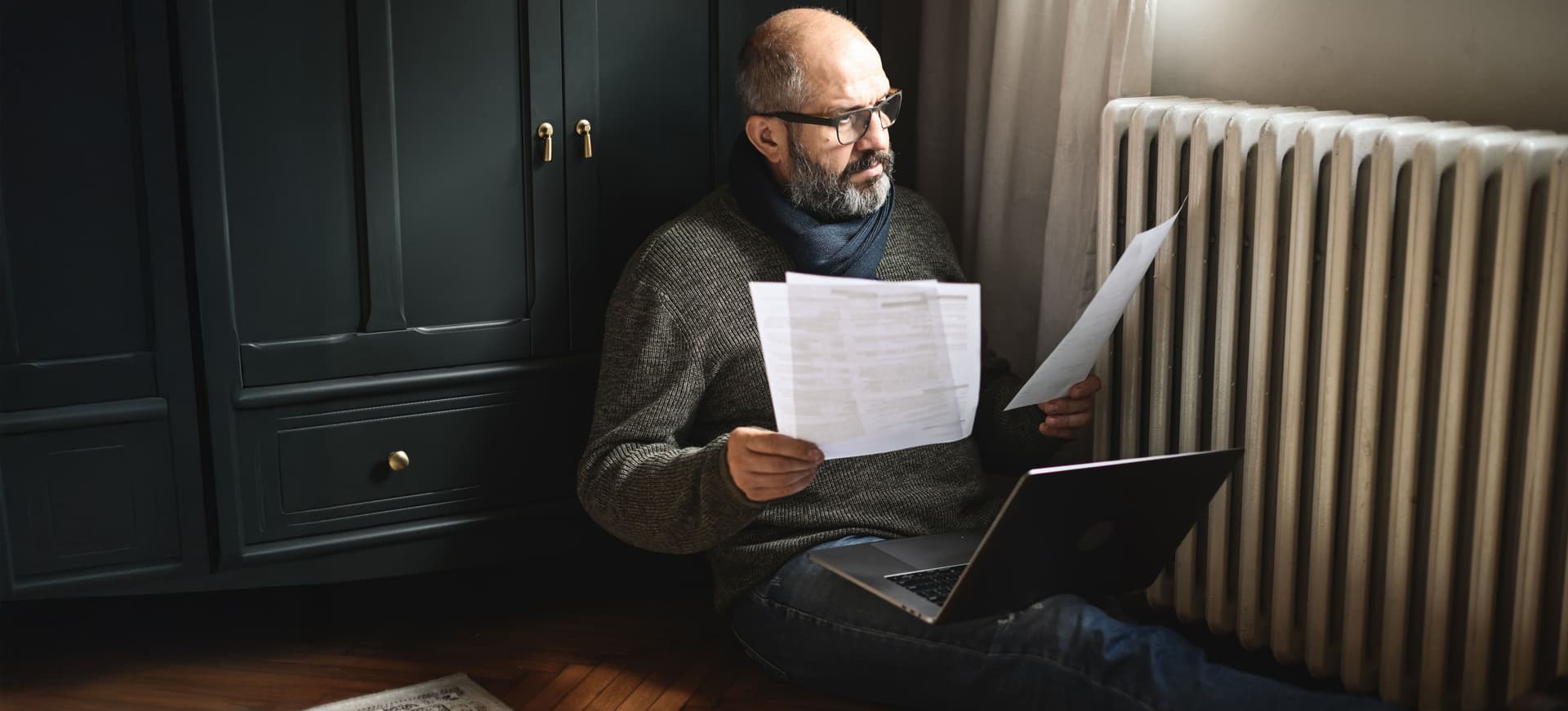
CO2-Steuer 2025: Was die Abgabe fürs Wohnen zur Miete und im Eigenheim bedeutet
Benzin, Gas und auch Heizöl sind 2025 teurer geworden. Grund ist der CO2-Preis: Er liegt nun bei 55 Euro pro Tonne – 10 Euro mehr als im Vorjahr. Für viele bedeutet das: Die monatlichen Kosten fürs Wohnen ziehen an. Was steckt hinter der Abgabe, warum wurde sie erhöht – und lässt sich die Belastung senken? Wir geben Antworten.
Der CO2-Preis stieg 2025 auf 55 Euro pro Tonne. Fossile Kraftstoffe und Brennstoffe wurden dadurch spürbar teurer – das wirkt sich direkt auf die Nebenkosten beim Wohnen aus.
Sowohl Eigentümerinnen und Eigentümer als auch Mietende sind betroffen. Bei Mietverhältnissen wird die Abgabe aufgeteilt, abhängig vom energetischen Zustand der Immobilie.
Energetisch modernisieren hilft doppelt: Wer in bessere Heiztechnik oder erneuerbare Energien investiert, senkt dauerhaft Kosten – und steigert zugleich den Wert seiner Immobilie.
CO2-Abgabe 2025: Kalte Dusche bei den Heizkosten
Seit Januar 2025 liegt der CO2-Preis – auch etwas ungenau CO2-Steuer genannt – bei 55 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 10 Euro. Für fossile Energieträger wie Heizöl oder Erdgas bedeutet das: Die Produkte sind teurer geworden – weil bei ihrer Verbrennung CO2 freigesetzt wird.
Viele Haushalte spüren das direkt bei den Heiz- und Nebenkosten, wenn mit Gas oder Öl geheizt wird. Mietende sind davon genauso betroffen wie Eigentümerinnen und Eigentümer.
Mehr zahlen fürs Klima
Die CO2-Bepreisung ist ein zentraler Teil der deutschen Klimapolitik. Sie soll dafür sorgen, dass klimaschädliches Verhalten weniger attraktiv ist. Wer fossile Brennstoffe nutzt, zahlt mehr.
- Wie fördert der CO2-Preis klimafreundliches Verhalten? Auf jede verbrauchte Kilowattstunde fossiler Energie entfällt ein Aufschlag. Energieanbieter geben diesen an die Haushalte weiter – spürbar etwa beim Heizen oder Tanken. Wer auf erneuerbare Energien oder moderne Heiztechnik umstellt, wird entlastet.
- Seit wann gibt es den CO2-Preis? Die CO2-Abgabe gilt in Deutschland seit 2021. Damals startete sie mit 25 Euro pro Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid.
- Warum steigt der Preis? Der Gesetzgeber hat von Anfang an eine stufenweise Erhöhung bis 2027 vorgesehen. Das schafft Planungssicherheit – und gibt Haushalten die Chance, auf klimafreundlichere Alternativen umzusteigen.
Sie möchten Ihre Modernisierung zeitnah angehen?
Emissionshandel: Damit weniger klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre gelangt
Der CO2-Preis orientiert sich an einem System, das als Emissionshandel (EU-ETS 1) bekannt ist. Es legt eine Obergrenze für die Menge an CO2-Emissionen fest, die Industrieunternehmen jährlich verursachen dürfen. Oder anders ausgedrückt: Wer als Firma Kohlendioxid ausstößt, muss dafür zahlen. Für jede ausgestoßene Tonne CO2 wird ein Emissionszertifikat benötigt. Diese Rechte werden entweder zugeteilt oder versteigert. Wer weniger ausstößt, kann überschüssige Zertifikate verkaufen. Wer mehr ausstößt, muss zusätzliche Rechte kaufen – das kostet. Großunternehmen in der Industrie, Stromerzeugung und Luftfahrt handeln also direkt mit Zertifikaten am Markt.
Im sogenannten nationalen Emissionshandelssystem (nEHS) gilt dasselbe Prinzip auch für Heiz- und Kraftstoffe. Hier kaufen Energieanbieter Zertifikate und geben die Kosten über höhere Preise für Gas, Heizöl oder Benzin an die Verbraucher weiter. Am Ende zahlen also Haushalte mit – und zwar umso mehr, je klimaschädlicher geheizt oder gefahren wird.
CO2-Preise ab 2027: Markt statt Festpreis
Der aktuelle CO2-Preis auf Gas, Heizöl und Benzin entsteht (noch) nicht durch Marktmechanismen des EU-Handels, sondern durch gesetzlich festgelegte Preisstufen im nationalen Emissionshandelssystem (nEHS). Ab dem Jahr 2027 soll dieses System dann in den EU-weiten Handel (EU-ETS 2) übergehen – mit schwankenden Marktpreisen. Der Einstiegspreis soll mindestens 55 Euro pro Tonne betragen, eine Preisobergrenze von 65 Euro gilt zunächst bis Ende 2027.
Was danach passiert, hängt von Angebot und Nachfrage ab. Fachleute rechnen langfristig mit deutlich steigenden Preisen – das könnte Wohnen mit fossiler Energie empfindlich verteuern.
Die Entwicklung der CO2-Abgabe in Zahlen:
Jahr | CO2-Preis pro Tonne |
|---|---|
2021 | 25 Euro |
2022 | 30 Euro |
2023 | 30 Euro (keine Erhöhung aufgrund der Energiekrise) |
2024 | 45 Euro |
2025 | 55 Euro |
2026 | 55 bis 65 Euro |
ab 2027 | Preisbildung durch Angebot und Nachfrage am Emissionshandelsmarkt |
So verteilt sich der CO2-Preis bei Miete und Eigentum
Der CO2-Preis betrifft alle, die mit fossilen Energieträgern heizen – also vor allem mit Erdgas, Heizöl oder Fernwärme aus fossilen Quellen. Nicht betroffen sind Haushalte mit Stromheizungen, Wärmepumpen oder Holzpellet-Anlagen.
In Mietverhältnissen müssen sich Vermietende und Mietende die CO2-Kosten seit dem Jahr 2023 teilen. Grundlage ist das sogenannte Stufenmodell, das den energetischen Zustand der vermieteten Wohnung beziehungsweise des Gebäudes berücksichtigt. Je schlechter dieser ausfällt, desto größer ist der Anteil, den die Vermietenden übernehmen müssen. Damit will der Gesetzgeber einen Anreiz für energetische Sanierungen schaffen. Wer modernisiert, wird entlastet.
Hinweis: Für Eigentümerinnen und Eigentümer in selbst genutzten Immobilien gilt so eine Aufteilung natürlich nicht – sie tragen die steigenden Kosten allein. Allerdings haben sie auch die volle Entscheidungsfreiheit, ob und wann sie modernisieren.
Aufteilung – das 10-Stufen-Modell im Überblick:
Je schlechter der Energiestandard pro Quadratmeter Wohnfläche, desto höher ist der Anteil der Kohlendioxidkosten für die Vermieterseite.
Hinweis: Liegt kein Energieausweis vor, muss die Vermieterseite pauschal 50 Prozent der CO2-Kosten übernehmen.
Energiestandard laut Energieausweis | Anteil für Vermieterinnen und Vermieter | Kostenanteil für Mieterinnen und Mieter |
|---|---|---|
sehr schlecht (mehr als 52 kg CO₂/m²) | 95 Prozent | 5 Prozent |
47 bis < 52 kg | 80 Prozent | 20 Prozent |
42 bis < 47 kg | 70 Prozent | 30 Prozent |
37 bis < 42 kg | 60 Prozent | 40 Prozent |
32 bis < 37 kg | 50 Prozent | 50 Prozent |
27 bis < 32 kg | 40 Prozent | 60 Prozent |
22 bis < 27 kg | 30 Prozent | 70 Prozent |
17 bis < 22 kg | 20 Prozent | 80 Prozent |
12 bis < 17 kg | 10 Prozent | 90 Prozent |
sehr gut (unter 12 kg CO₂/m²) | 0 Prozent | 100 Prozent |
CO2-Abgabe auf der Nebenkostenabrechnung finden
Vermietende müssen seit 2023 ausweisen, wie hoch die CO2-Kosten sind und welcher Anteil davon auf sie sowie auf die Mietpartei entfällt. In der Regel tauchen die Kohlendioxidkosten für Mieterinnen und Mieter also auch in ihrer Heiz- oder Nebenkostenabrechnung auf – etwa als „CO2-Bepreisung“ oder „Kostenanteil CO2 nach § 6 CO2KostAufG“.
Was Sie tun können, um Ihre CO2-Kosten zu senken
Je weniger fossile Energie Sie verbrauchen, desto niedriger fällt Ihre CO2-Abgabe aus. Wer Gas oder Ölheizung gegen moderne Technik tauscht, spart also gleich doppelt – beim Energieverbrauch und bei den CO2-Kosten. Für Eigentümerinnen und Eigentümer lohnt sich daher ein genauer Blick auf den energetischen Zustand des Hauses:
- Wie alt ist die Heizungsanlage – und wie effizient arbeitet sie?
- Wie gut sind Dach, Fassade und Fenster gedämmt? Ein professioneller Energiecheck kann helfen, Schwachstellen aufzuspüren.
Übrigens: Die Bundesregierung unterstützt den Heizungstausch im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Je nach Maßnahme und persönlicher Situation sind Zuschüsse von bis zu 70 Prozent der Investitionskosten möglich.
Ihre Einsparmöglichkeiten im Überblick
- Wärmepumpe
Wärmepumpen nutzen Umweltwärme und arbeiten in Kombination mit Photovoltaikanlagen besonders effizient. Dank staatlicher Förderungen lassen sich die Anschaffungskosten deutlich reduzieren.
- Pelletheizung
Pelletheizungen nutzen nachwachsende Rohstoffe und bieten eine klimafreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Die Betriebskosten sind oft niedriger, und auch hier unterstützt der Staat mit attraktiven Zuschüssen.
- Solarthermie
Solarthermie nutzt Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Sie ergänzt bestehende Systeme sinnvoll und senkt den Energieverbrauch weiter.
Angesichts steigender Energiepreise und der CO2-Bepreisung lohnt es sich, frühzeitig über einen Wechsel zu einem klimafreundlichen Heizsystem nachzudenken.
Hinweis: Auch Mietende können etwas tun – etwa durch Ihr individuelles Heizverhalten, den Einsatz passender Thermostate oder das Gespräch mit der Vermieterseite über mögliche Modernisierungen. Verbraucherzentralen bieten zudem häufig kostenlose oder kostengünstige Energieberatungen speziell für Mieterinnen und Mieter an.
Wenn Sie wissen möchten, was eine energetische Modernisierung in Ihrem Fall kosten würde – und wie viel Sie dadurch sparen können, dann nutzen Sie den Modernisierungsrechner der Sparkasse. Er zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Investitionen sinnvoll sind und wie sich die Maßnahmen auf Ihren Energieverbrauch und Ihre Kosten auswirken.
Eine energetische Sanierung verbessert den Wohnkomfort und steigert den Wert Ihrer Immobilie. Unser Modernisierungsrechner hilft Ihnen, alle Kosten und Maßnahmen im Blick zu behalten und einen umfassenden Plan zu erstellen – mit Details zu Energiebedarf, geeigneten Maßnahmen, staatlichen Förderungen und möglichen Einsparungen.
CO2-Kosten senken: Was sagt die Energieberatung aus der Praxis?
Energetische Sanierungen sind zentrale Stellschrauben, um CO2-Kosten zu senken. Doch viele Eigentümerinnen und Eigentümer fragen sich: Wie starte ich, vor allem wenn das Budget begrenzt ist? Wir haben bei Jutta Maria Betz, Vorstandsmitglied des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e.V., nachgefragt. Sie kennt die Herausforderungen aus erster Hand.

Im Interview mit
Jutta Maria Betz
Frau Betz, welche Einsparpotenziale beobachten Sie in der Energieberatung bei Haushalten, auch unter Berücksichtigung der CO2-Kosten?
„Das hängt sehr stark vom Ausgangszustand ab. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel aus einem unserer Beratungstermine: Eine junge Familie hat ein typisches Gebäude aus den 70er-Jahren gekauft, ein altes Reihenendhaus, das sie sanieren müssen und wollen. Die machen hier dann sinnvollerweise noch vor ihrem Einzug das volle Programm an Modernisierungsmaßnahmen – die Außenwände, Fenster, das Dach und die Heizung

Wenn – wie in diesem Fall – die Gebäudehülle verbessert und zusätzlich die alte Gasheizung ersetzt wird, sinken die CO2-Emissionen deutlich: von ursprünglich 8,8 auf nur noch 2,2 Tonnen pro Jahr. Und mit einer Wärmepumpe entfallen künftig sogar sämtliche CO2-Abgaben, weil kein fossiler Brennstoff mehr eingesetzt wird. In der Version mit alter Gasheizung würde das sanierte und gut gedämmte Haus dagegen noch bei rund 3,4 Tonnen pro Jahr liegen. Die steigende CO2-Bepreisung macht die Maßnahmen also noch wirtschaftlicher – vor allem im Zusammenspiel.“
Was raten Sie Interessierten, die energetisch sanieren möchten, aber angesichts hoher Kosten zögern?
„Wichtig ist die Erkenntnis, dass Sie als Eigentümerin oder Eigentümer eines Hauses aus zum Beispiel den 80er- oder 90er-Jahren nicht alles auf einmal machen müssen. Vielleicht haben Sie noch eine alte Gasheizung, aber im Laufe der Jahre bereits andere Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, beispielsweise zweifach wärmeschutzverglaste Fenster eingebaut. Diese müssen Sie jetzt natürlich nicht wegschmeißen und gegen dreifach verglaste austauschen! Wichtig ist immer der langfristige Blick aufs Gebäude und auf die Lebenserwartung einzelner Bauteile. Sanieren Sie vorausschauend: Wenn Sie Maßnahmen ergreifen, dann immer so gut wie möglich. Halbherzige Maßnahmen einige Jahre später nachbessern zu wollen, rentiert sich wirtschaftlich nie.
Wir empfehlen daher, Schritt für Schritt mit einem individuellen Sanierungsfahrplan zu starten, in Übereinstimmung mit dem Restwert vorhandener Bauteile. Damit sehen Sie, in welcher Reihenfolge sich Modernisierungen sinnvoll umsetzen lassen – um dann wieder die nächsten 30 bis 50 Jahre zu halten. Je früher Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, desto länger können Sie Energiekosten sparen. Gerade bei begrenztem Budget lohnt sich zudem der Blick auf Förderprogramme und mögliche Steuervergünstigungen. Eine individuelle Beratung zahlt sich hier wirklich aus.“
Die CO2-Bepreisung setzt langfristig auf Verhaltensänderung. Sehen Sie spürbare Effekte? Denken Eigentümerinnen und Eigentümer heute anders über energetische Maßnahmen als noch vor wenigen Jahren?
„Ja und nein. Ich habe noch nicht den Eindruck, dass die Entscheidungen von Eigentümerinnen und Eigentümern aktuell von der CO2-Abgabe abhängen. Das ist durch die Preisbindung bis einschließlich 2026 tatsächlich noch kein treibender Faktor. Denn 55 Euro pro Tonne CO2 in 2025 bedeuten umgerechnet: Der CO2-Preis ist um 1,31 Cent pro Kilowattstunde (bei Erdgas; 1,70 Cent pro Kilowattstunde bei Heizöl) gestiegen. Die Abgabenhöhe liegt also aktuell noch in einem Bereich, der nicht über die üblichen Preisschwankungen hinausgeht. Plakativer ausgedrückt: Es tut noch nicht wirklich weh im Geldbeutel.
Was nach 2026 passiert, wenn wir am europäischen Emissionshandel teilnehmen, wissen wir aber nicht. Liegt der CO2-Preis dann bei 180 Euro oder bei 300 Euro? Dann wird aus dieser Abgabe plötzlich eine nennenswerte Größe, die ich on top zum Rohstoffpreis bezahlen muss. Bei der Motivation, energetisch zu sanieren, überlagern sich zudem viele Aspekte. Die CO2-Kosten spielen eine Rolle, aber Themen wie Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit von fossilen Energien stehen heute viel mehr im Fokus. Es gibt mehr Interesse an nachhaltigen Lösungen, aber auch mehr Unsicherheit, gerade in Bezug auf die technische Umsetzbarkeit und die Förderbedingungen. Die Informationslage ist komplex. Wir betreiben da viel Aufklärung in den individuellen Gesprächen.“
Klimakosten im Blick behalten – und Spielräume nutzen
Der CO2-Preis macht Wohnen mit fossiler Energie teurer – und diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Wer zur Miete wohnt, kann bei ineffizienten Gebäuden nur auf eine faire Aufteilung der Kosten bauen. Wer dagegen selbst Eigentum besitzt, hat alle Stellschrauben in der Hand: energetisch modernisieren, Förderungen nutzen und so dauerhaft Heiz- und Klimakosten senken.
Sie möchten Ihre Modernisierung zeitnah angehen?
Die wichtigsten Fragen zur CO2-Bepreisung 2025
Die Erhöhung des CO2-Preises auf 55 Euro pro Tonne ist zum 1. Januar 2025 in Kraft getreten. Der Preis folgt einem gesetzlich festgelegten Stufenmodell, das bereits seit 2021 gilt. Ursprünglich war dieser Preissprung schon für 2023 geplant, wurde aber aufgrund der Energiekrise verschoben.
Die Steuer verfolgt das Ziel, klimaschädliches Verhalten durch finanzielle Anreize unattraktiver zu machen. Mit der Bepreisung von CO2 soll sich der Energieverbrauch verändern: Wer weniger fossile Brennstoffe nutzt oder in eine bessere Gebäudedämmung investiert, spart langfristig Geld. Der CO2-Preis lenkt also nicht nur das Verhalten, sondern fördert auch Investitionen in klimafreundliche Technik.
Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung fließen größtenteils in den Bundeshaushalt und sollen dabei helfen, die Energiewende voranzutreiben. Dazu gehören Förderprogramme für energetische Sanierungen, Zuschüsse für klimafreundliche Heizsysteme und Entlastungen für Haushalte mit geringem Einkommen.
Ja – aber nicht allein. Seit 2023 gilt ein Stufenmodell, das die CO2-Kosten fürs Heizen zwischen Vermietenden und Mietenden aufteilt. Der jeweilige Anteil richtet sich nach dem energetischen Zustand der gemieteten Wohnung beziehungsweise des Gebäudes. In unsanierten oder schlecht gedämmten Häusern tragen die Vermietenden bis zu 95 Prozent der CO2-Kosten. In sehr gut sanierten Gebäuden zahlen die Mietenden bis zu 100 Prozent.
Seit dem 1. Januar 2023. Die Regelung gilt für alle Mietverhältnisse, bei denen mit Erdgas oder Heizöl geheizt wird. Die Höhe des Kostenanteils richtet sich nach dem jährlichen CO2-Ausstoß des Gebäudes pro Quadratmeter Wohnfläche – Grundlage ist in der Regel der Energieausweis.
Im Jahr 2025 beträgt der CO2-Preis 55 Euro pro ausgestoßener Tonne. Das sind 10 Euro mehr als im Vorjahr. Je nach Verbrauch steigen dadurch die Heizkosten um mehrere hundert Euro pro Jahr.
Sie verteuert das Heizen mit fossilen Energien. In Mietverhältnissen sorgt das Stufenmodell dabei für eine gerechtere Aufteilung:
- Wer in einem unsanierten Gebäude lebt, zahlt meist nur einen kleinen Anteil der CO2-Kosten, während die Vermieterseite stärker belastet wird.
- In modernisierten Gebäuden zahlen Mietende mehr – profitieren dafür aber oft auch von niedrigeren Heizkosten insgesamt.
Eine Mieterhöhung verändert übrigens nichts an der CO2-Kostenverteilung. Die CO2-Abgabe bleibt Teil der Betriebskosten und wird nicht über die Kaltmiete abgerechnet. Sie fällt also unabhängig davon an, ob die Miete steigt oder nicht. Kommt es durch eine energetische Sanierung zu einer Mieterhöhung – etwa über die Modernisierungsumlage –, sinken in der Regel die CO2-Kosten, weil das Gebäude danach effizienter arbeitet. In solchen Fällen kann sich eine erhöhte Miete also teilweise durch niedrigere Betriebskosten ausgleichen.

Redakteur
Das Titelbild dieses Artikels wurde mittels KI-gestützter Bildbearbeitung angepasst.


